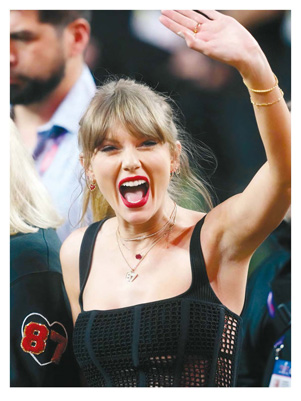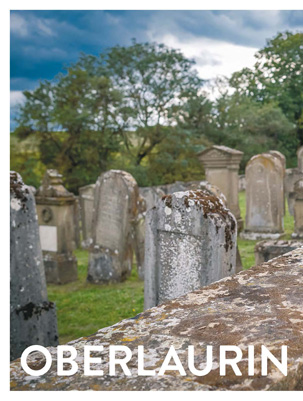Geschlecht oder Freiheit?
Es ist noch Frühling, aber ich weiß schon jetzt, was mein Buch des Jahres ist, nämlich: „Afghanistans verborgene Töchter“ von Jenny Nordberg. Die in New York arbeitende Schwedin hat sich für zwei Jahre nach Afghanistan begeben – und ein Buch veröffentlicht, das eine mitreißende Mischung ist aus Reportage, Studie und Essay – und eine Quelle der Erkenntnis.
Nordberg widmet ihr Buch „jedem Mädchen, das herausgefunden hat, dass es in Hosen schneller laufen und höher klettern kann“. Solche Mädchen gibt es sogar in Afghanistan, dem Land, in dem die Frauen ans Haus gekettet sind und in der Öffentlichkeit unsichtbar unter der Burka. Allerdings müssen diese Mädchen für die Freiheit zu laufen und zu klettern die Seite wechseln: Sie müssen als Jungen leben.
In Amerika nennt man sie Tomboy, in Frankreich Garçon manqué
„Bacha Posh“ werden solche Jungen auf Zeit in Afghanistan genannt. In Amerika nennt man sie Tomboy und in Frankreich Garçon manqué (verpasster Junge). Nur in Deutschland, dem Land der Gretchen und ihrer Töchter und Enkelinnen, gibt es bezeichnenderweise noch nicht einmal einen Namen für die Geschlechtsrollen-Wechslerinnen.
Doch ist es auch in Afghanistan keineswegs so, dass die Bacha Posh ein bekannter Begriff wären. Man muss schon so unerschrocken und behutsam zugleich recherchieren, wie die kühne Schwedin es getan hat, um ihnen auf die Spur zu kommen. Und siehe da, wo eine Bacha Posh ist, da ist noch eine und noch eine. Oft ahnen oder wissen es auch Nachbarn oder LehrerInnen, doch es wird toleriert, was die Familie des Tomboys entschieden hat.
Denn es sind die Familien, genauer gesagt die Väter, die diese Töchter ausbrechen lassen in die Freiheit der Söhne. Die Mütter alleine hätten gar nicht die Macht dazu. In Afghanistan ist es in der Regel ein Ausbruch auf Zeit, bis zur Pubertät, zum Schock der ersten Periode. Will ein Mädchen dann nicht zurückkehren in das Gefängnis der Frauenwelt, sondern weiterhin in der Welt der Männer leben, wird es schwierig. Sehr schwierig.
Die Motive von Mehran, Nadar, Shukris oder Shuhud, als Junge zu leben, sind unterschiedlich. Mal braucht die Familie nach einer Reihe von verachteten Mädchen-Geburten einfach dringlich einen Sohn, zu ihrer Ehrenrettung. Mal muss eines der in der Regel vier bis acht Kinder im Laden des Vaters mitarbeiten, damit die Familie genug zu essen hat – aber das darf nur ein Junge. Mal ist das Mädchen selber auch von Anfang an auffallend wild und selbstbewusst, und man lässt es gewähren. Oder ein aufgeklärter Vater hatte früher einfach selber Spaß an einer intelligenten Tochter und ermutigte sie, sich als Mann auf Zeit Freiheiten zu nehmen, die sie als Frau selbst im einst modernen Kabul nicht gehabt hätte. Das war in der Zeit der Sowjets in Afghanistan, die darauf drangen, dass die Mädchen die gleiche Bildung und Frauen die gleichen Chancen erhielten.
Die Reporterin spürt die Bacha Poshs auf, nähert sich ihnen mit Respekt und beobachtet sie sehr genau. Ihre Studien dieses „Doing Gender“, wie die Genderforschung das Erlernen der Geschlechtsrollen nennt, stellt Hunderte von akademischen Studien in den Schatten. Nordberg studiert sowohl den Schritt vom biologischen Mädchen hin zum sozialen Jungen – als auch den vom „Jungen“ zurück zur „Frau“. Die Stimmen der Jungen sind tief, ihre Schritte sind groß, ihre Bewegungen sind ausladend, egal welchen biologischen Geschlechts sie sind. Die Stimmen der Mädchen sind kaum hörbar und hell, ihre Schritte trippelnd, der Kopf ist gesenkt. Die Autorin selbst, die in New York lebende Schwedin, wird unter der Burka für einen Mann gehalten: zu aufrechter Gang, zu große Schritte, zu raumgreifende Bewegungen.
Ganz en passant vermittelt Nordberg uns gleichzeitig nicht nur die so wechselvolle Geschichte von Afghanistan, sondern auch das quasi geheime Wissen um die Welt der Frauen. Denn die findet bis heute in keinem Geschichtsbuch, keiner wissenschaftlichen Studie, kaum einem Artikel einen Niederschlag. Die Frauenwelt in Afghanistan ist eine No-Go-Area für AusländerInnen.
Und auch die jüngere Geschichte Afghanistans ist überraschend. Wer weiß schon, dass König Amanullah Khan bereits in den 1920er Jahren versuchte, die Gleichberechtigung in Afghanistan einzuführen und Königin Soraya sich damals demonstrativ öffentlich das Kopftuch vom Kopf riss? Wer erinnert sich, dass König Mohammed Zahir Shah 1964 in Afghanistan die Gleichberechtigung und das Frauenwahlrecht einführte und privilegierte Afghaninnen zum Studium ins Ausland geschickt wurden? Und es ist ja noch nicht so lange her, dass in der „russischen Zeit“, in den 1980er Jahren, die Afghaninnen sich so frei bewegen konnten wie die Männer, dass sie studierten und Liebesheiraten eingingen.
Allerdings war die Modernisierung immer beschränkt auf die Städte, auf dem Land tickten die Uhren weiterhin anders. Das afghanische Patriarchat war dort unerschüttert. Die Frauen blieben Besitz des Vaters oder Ehemannes, und innerhalb der Familien regierten mit harter Hand die Schwiegermütter.
Immer wieder macht Nordberg auch Ausflüge in die Geschichte des Westens, wo noch vor wenigen Generationen ähnliche Verhältnisse herrschten, und es ebenfalls noch nicht so lange her ist, dass Frauen, die lernen und frei sein wollten, Männer sein mussten. Auch im Westen kam damals nicht selten erst beim Tod der tapferen Piratin oder Kriegerin heraus, dass unter der Uniform ein Busen steckte.
Im heutigen Afghanistan begleiten wir zusammen mit der Autorin den Lebensweg von Azita, die in der „russischen Zeit“ vom Vater, einem Universitätsprofessor, zum Studium ermutigt, im nahenden Krieg jedoch an einen analphabetischen Cousin zwangsverheiratet wird und Mutter von vier Töchtern. Darunter Mehran, die Jüngste, die sie zum Bacha Posh macht, wie sie es einst selber war. Azita schafft es, trotz widrigster Umstände, Abgeordnete zu werden. Doch sie fällt einem Wahlbetrug zum Opfer – und zurück in die harten Hände ihres schwachen, grausamen Mannes. Was wohl wird aus Mehran werden, ihrer jüngsten Sohn-Tochter?
Und wir folgen Nadar und Shahud, Informatikerin und Polizistin, die nicht mehr zurück wollen in die Enge der Frauenrolle und es nun, mit Mitte dreißig, fast geschafft haben. Denn wenn eine afghanische Frau erstmal nicht mehr heiratbar, weil nicht mehr gebärfähig ist, lässt man sie gewähren. Sie darf weiterhin ein Männerleben führen.
Ihrem Kapitel über die „Väter“, für Jenny Nordberg Schlüssel zur Frauenemanzipation, stellt die Autorin folgendes Motto voran: „‘Du kannst, wenn du willst.‘ – Ein Vater zu seiner Tochter in den achtziger Jahren auf einer Skipiste in Schweden.“ Anzunehmen, dass Jennys Vater diesen Satz gesagt hat. Und der ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen.
Mal ganz abgesehen davon, dass Nordberg eine brillante Autorin ist (und zu recht Pulitzer-Preisträgerin), ist sie auch eine unerschrockene Reporterin, die die luxuriösen Ausländer-Gettos in Kabul, auch der NGOs, mit Verachtung schildert. Sie wagt es, das Alltagsleben der Menschen in Afghanistan zu teilen.
Ein Buch, das keine und keiner verpassen sollte. Und schon gar nicht die Bacha Poshs dieser Welt.
Alice Schwarzer
Weiterlesen
Jenny Nordberg: „Afghanistans verborgene Töchter. Wenn Mädchen als Söhne aufwachsen“. Übersetzung: Gerlinde Schermer-Rauwolf/Robert A. Weiß (Hoffmann und Campe, 22 €)